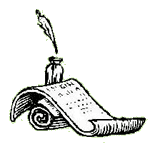!!HILFERUFE AUS EINEM BUCH!!
Ich saß in der Bücherei, dachte an nichts Böses und schmökerte in meinem Lieblingsbuch. Während ich so in Gedanken dahinschwelgte und daran dachte, wie gerne ich auch einmal in einem Buch die Hauptrolle spielen würde, spürte ich auf einmal, wie eine eiskalte Hand auf meiner Schulter lag.
Mein Körper zuckte zusammen, ein Gefühl aus Neugier und Angst stieg in mir auf, mein Blick streifte noch einmal über das Deckblatt des Buches, auf dem Rae abgebildet war, und prägte sich alle, nur irgendwie erhaschbaren, Details ein.
Erstaunlich viel Überwindung war nötig, bis ich endlich bereit war, mich ganz umzudrehen. — Es war eine weiße, ganz leichte Hand, die noch immer auf meiner Schulter ruhte. Obwohl ich mich aufrichtete, blieb sie genau an der Stelle liegen. Nun wollte ich es wirklich wissen, wer war das? Ganz langsam, - wie in der Zeitlupe eines Elf-Meters drehe ich mich um, erst jetzt fiel mir auf, dass die Bücherei komplett leer war. Nur ich war noch da und diese mysteriöse Hand auf meiner Schulter. In Sekundenschnelle versuchte ich mir einen Fluchtplan parat zu legen, einen Weg, wie ich am schnellsten hier weg konnte und wieder in der Menge auf dem Marktplatz untertauchen konnte.
Nun war es soweit, ich hatte mich umgedreht. Alle Gedanken an Flucht verschwanden, im ersten Moment wusste ich gar nicht warum, mein Gehirn brauchte einen Moment, um zu registrieren, wer da vor mir stand. Ich blickte in diese Augen, suchende graublaue Augen sahen mich an. Ein Gesicht ohne jeden Ausdruck von Gefühlen. Ein weißes, fast totenbleiches Gesicht mit kalten blaugrauen Augen und einem glatten, leicht fettigen roten Haarschopf. Die kalte Hand glitt von meiner Schulter und als hätte sie mich festgehalten taumelte ich einen Schritt zurück, ich konnte nicht glauben, was ich da sah, sie stand vor mir, sie musste es sein, der Blick, dieses Gefühl in ihrer Nähe und dieser Abgrund, in den man sah, sobald man einen Blickkontakt aufbauen wollte. - Das Ticken der mechanischen Uhr war wie Lärm und die Zeit von einem Tick zum anderen war wie eine Ewigkeit. Erst jetzt merkte ich, dass mir vor lauter Staunen den Mund offen stand, schnell schloss ich ihn. Nun begann ich allmählich zu verstehen, dass es wahr war, was ich sah. Ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, denken zu wollen, hob ich meine Hand und strich ihr über den Arm, der flauschige Pullover hatte auf der Höhe des Ellenbogens einen Riss, ich sah wieder zu ihr auf.
Das Ticken der Uhr wurde immer leiser und schließlich schalteten sich meine Sinne wieder ein: „Rae!“ — Das Schweigen zerbrach wie eine Fensterscheibe, die in tausend Splitter zu Boden fiel.
Rae stand stumm vor mir und blickte mich nun mit einem Ausdruck von Skepsis und leichter Freude an, dann nickte sie.
Suchend schweifte ihr Blick durch den Raum, neugierig folgte ich ihm, dabei bemerkte ich, dass mein Buch, nein ihr Buch, das Buch, in dem ich gerade noch gelesen hatte, verschwunden war.
„Wir brauchen deine Hilfe! Du musst mitkommen und mit Anthony reden, wir müssen Jesse finden, die Zeit läuft davon!“, platzte Rae auf einmal heraus und zog mich am Arm. Meine Füße begannen schon mit ihr mit zu rennen, während mein Gehirn erst empfing, was sie da gerade von mir verlangt hatte.
- Ich träumte, ja ich musste träumen, das konnte doch alles nicht wahr sein, Rae hier in Deutschland und noch dazu gerade bei mir! So viele hatten dieses Buch gelesen, warum tauchte sie ausgerechnet bei mir auf?
Ehe ich mich versah, saßen wir auch schon im Bus und fuhren zum Flughafen. Verwirrt blickte ich durch die Sitzreihen, auch hier war alles menschenleer, nein, in der letzten Reihe saß noch jemand, ein Junge, die Bac-cappe in die Stirn gezogen, die Arme vor der Brust verschränkt und die Beine gespreizt von sich gestreckt — das konnte ja nicht wahr sein, auch Anthony war hier, es konnte nur Anthony sein, die Haltung, der Gesichtsausdruck, genauso hatte ich ihn mir immer vorgestellt. Nun, als der Bus in voller Fahrt auf der Schnellstraße unterwegs war, richtete er sich auf und kam zu uns nach vorne. Rae saß schon die ganze Zeit mir gegenüber und beobachtete mich, in diesem Moment huschte mir die Frage durch den Kopf, wie ich wohl guckte, doch nach kurzer Kontrolle wusste ich, dass ich normal schaute, mein Mund war geschlossen und mein Blick starr zum hinteren Ende des Busses gerichtet.
„Ist sie das? Wieso habt ihr solange gebraucht?“, schallte Anthonys Frage wie aus einem Megafon durch den leeren Bus. „Ja, das ist sie! Und sie hat auch einen Namen! Denke bitte daran, dass wir sie brauchen!“, entgegnete Rae in einem verteidigenden Ton, ohne ihren Blick von mir abzuwenden. Ich hätte es nicht für richtig gefunden, mich jetzt zu Wort zu melden, egal wie viele Fragen mir gerade durch den Kopf gingen. So blieb ich schweigend sitzen und hörte zu.
„Du tust gerade so, als könnten wir nicht ohne sie weiter suchen! Und überhaupt, woher wissen wir, dass sie diejenige ist, die wir suchen?“, platzte es aus Anthony heraus, auf seine direkte und unüberdachte Art, genau wie in allen Büchern, doch was hatte ich hier zu suchen? Warum haben die beiden mich gesucht, warum soll Jesse verschwunden sein? Das geschah doch schon im zweiten Band!
„Sie ist die Einzige, die weiß, wie es weiter geht! Wir brauchen sie …“, sie wurde von Anthony unterbrochen:“ Ah, nun hast du sie auch nicht beim Namen genannt! Hast du ihr überhaupt schon gesagt, was ihre Aufgabe ist?“
„Nein, sagte Rae und senkte nun endlich ihren Blick von mir weg, hielt einen Moment inne und starrte dann aus dem Fenster.
„Alles bricht zusammen, Jesse ist verschwunden und wir haben Wanzen im Auto gefunden, ich weiß nicht mehr, wem ich vertrauen kann. Du, Marina bist die Einzige, die uns helfen kann. Du weißt, wie es weiter geht und du bist die Einzige, die sich uns richtig vorgestellt hat. Wir brauchen deine Hilfe. Bitte!", begann Rae in einem total aufgewühlten Ton zu sprechen, aber ohne mich anzusehen, ich spürte, dass ihre Fassade zu brechen begann, ich hörte die bittere Enttäuschung, die dahinter stand.
Nun war mein Zeitpunkt gekommen, ich war an der Reihe zu sprechen, ich spürte Anthonys Blick, der auf mir lagerte, so schwer, als wären meine Schultern aus Blei. Ich öffnete den Mund, doch ich war nicht im Stande zu sprechen.
Ich schloss die Augen und holte tief Luft, alle Anspannung fiel von mir ab, ich fühlte mich geborgen, als ob ich dazu gehören würde. „Ich kann euch doch nicht erzählen, was da alles geschrieben steht! Es ist eure Aufgabe das herauszufinden, was geschehen ist. Ihr habt es doch bisher immer geschafft, wenn ich die Bücher gelesen habe, was ist denn diesmal anders? Ihr müsst vorsichtig sein!“, nun lenkte auch ich meinen Blick zu den gegenüberliegenden Fenstern, doch ohne hinaus zu sehen, mein Blick ging in eine vertraute Leere.
„Wir wissen nicht, wem wir trauen können!“, sagte Anthony, während er sich nun endlich hinsetzte. „Ich habe keine Ahnung, wo ich Jesse suchen soll, seit Yana wieder aufgetaucht ist, haben wir keine ruhige Minute mehr.
„Moment mal! Yana ist WIEDER aufgetaucht, soll das heißen Jesse ist zum zweiten Mal entführt worden?“, nun begann ich zu begreifen, was hier geschah, es ging nicht um den zweiten Band, nein, es ging um die Realität, um das Hier und Jetzt. Es war eine ganz neue Zeit, alles, was nach dem achten Band geschieht. Aber ich gehörte hier nun einmal nicht hin! „Nutze deine Gabe und haltet zusammen! Deine Mutter hat dir diese Gabe mitgegeben, sie wird dich schützen. Ich darf mich nicht ich euer Leben einmischen! Ich bin nun mal ein „normaler“ Mensch! Ich darf eure Geschichte nicht verändern! Aber denk bitte nach, bevor du etwas tust, Rae. Was liebt Yana, du hast sie doch über ein Jahr kennen gelernt, das war nicht alles Fassade, im Inneren war noch vieles gleich, sie ist nicht nur Hass! Sie ist ein Mensch, der um seine Mutter trauert, genau wie du! Denke daran, was sie mag, dann wirst du sie auch finden! … da bin ich mir sicher!“
„Ein trauernder Mensch …“, wiederholte Rae. „Sie hat auch schon früher einmal gesagt, wir seien uns ähnlicher, als wir denken …" Der Bus hielt an, wir waren schon am Flughafen angekommen. Ohne ein Wort zu sagen, stiegen wir aus.
Erst als wir am Gate standen, sprach Rae wieder mit mir: "Danke für deine Hilfe! Ich denke, ich habe dich verstanden."
Ich wollte mich nicht einmischen, aber dies war wohl meine erste und letzte Chance, dies los zu werden. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und flüsterte Rae ins Ohr:“ Bitte entscheide dich für Anthony und zeig ihm deine Gefühle, Marcus hat dich schon vergessen! Bitte mach dich nicht unglücklich und sei ehrlich zu dir, sei dir bewusst, dass dein Vater auch deiner Mutter beigestanden hat. Er wird auch dir helfen.“
Rae nickte, hielt noch einen Moment inne, doch dann liefen sie und Anthony ohne ein Wort des Abschiedes zu ihrem Flugzeug, stiegen ein und flogen zurück.
— Zurück in ihre Welt.
Völlig in Gedanken versunken lief ich durch die leere Wartehalle, - das Ticken der mechanischen Uhr war wie Lärm und die Zeit von einem Tick zum anderen war wie eine Ewigkeit.
Nun war ich zurück in meiner Welt, ohne Rae und ohne Anthony.
1943 - 24. Dezember???
Die Dunkelheit war schon wie ein stummer Schatten übers Land gezogen. Verstummt waren Straßen und Felder. Um so lauter war der tosende Wind, der durch jede Ritze der Ruinen blies.
Das Gesicht des Himmels war nicht getrübt, der Glanz seiner tausend Augen wirkte, nicht zuletzt durch den Sturm, kalt und feindlich.
Man spürte es ganz deutlich; hier war etwas geschehen, etwas Schreckliches und Unverhofftes, das alle Menschen erschütterte und zutiefst berührte. Keiner hatte damit gerechnet, nicht hier, nicht heute!
Florentine saß in den langsam abkühlenden Trümmern. Sie hatte ihren Teddy im Arm und das Kinn auf die Knie gelegt. Sie weinte, wie Lava rannen die glühenden Tränen über ihre fast erfrorenen Wangen. In der Erinnerung war noch die Hoffnung zu sehen, die das ganze Dorf gehabt hatte.
Doch nun war auch die Hoffnung zu einem gesichtslosen Schatten geworden, der hilflos umherirrte. Noch in den frühen Morgenstunden des nun so grauenvoll endenden Tages hatte Florentine mit ihrer Mutter über das so nahe Fest gesprochen, was für ein schöner Tag das morgen geworden wäre … trotz all dessen, was in der großen Welt unvergängliche Narben schnitt. — Niemals hätte es ein Auge geglaubt, die gerade noch existierende Idylle nun in solch schrecklichem Gewand anzutreffen.
Florentine war noch zu jung, um alles wirklich begreifen zu können, doch was sie konnte, war fühlen, vermissen. Sie fühlte die unbekannte Leere, die sie nun erfüllte, die schützenden Hände ihrer Mutter vermisste sie. Zurückgeblieben, wie eine einzige Kaulquappe im Ozean saß sie in den nun eingefrorenen Trümmern des Hauses. In der ganzen Aufregung, während des kalten Schnittes in ihre Seele saß sie immer still, schweigend an der selben Stelle. Den kleinen Teddy in den Armen haltend, hatte sie alles mit angesehen.
Ihre grauen, ja nun fast schwarzen Augen hatten wahrgenommen, wie sie kamen, die Flieger. Sobald das Heulen des Windes einmal nachließ, begann in ihren Ohren wieder der Lärm, den die Bombenflieger ausgestoßen hatten. — Sie waren der Wahrnehmung der einzelnen Ohren schon entflogen, als der gewaltige und viel Schmerzen bringende Krach erklang.
Keiner konnte es glauben. Alles war erstarrt, unfähig sich zu rühren, den Blick auf etwas anderes zu wenden und nicht im Entferntesten zur Flucht bereit. — Sie hatten es tatsächlich getan. Über einem kleinen, unbedeutenden Dorf hatten sie Bomben, tosende, todbringende Pfeile abgeworfen, das Dorf als Zielscheibe verwendet.
Noch nie hatte Florentine so etwas gesehen. In der Schule, in der sie vor drei Monaten das letzte Mal gewesen war, hatten sie einmal über diese Ungetüme der Lüfte gesprochen, der Lehrer meinte dies sei nun “normal“, Hitler wolle das so!
In den letzen Monaten hatte sich in dem kleinen Dorf so vieles verändert. Alle Väter wurden mit dem Zug abgeholt und zu „Hitler" gebracht. So hatten es die Erwachsenen immer erzählt. Florentine ließ ihren Blick orientierungslos über die Steinhaufen schweifen. Dort hatte die Schule gestanden, doch das Einzige, was man noch sah, war der Brunnen, der schon seit ewiger Zeit neben dem kleinen Gebäude stand.
Fassungslos sah Florentine die Straße entlang, bis sie auf einmal einen Schatten sah. Sie blinzelte und wischte sich die Tränen aus den Augen. — Wer kam da so zielstrebig und schwer beladen auf sie zu? Was wollte dieses „unbekannte“ Wesen von ihr?
Nun erkannte sie diese „unbekannte“ Gestalt. Es war Emelie, ihre große Schwester. Sie war zu der Zeit des Angriffes im Wald gewesen und hatte unvorstellbares Glück gehabt, dass sie nicht von den Druckwellen verletzt worden war.
Florentines Augen glänzten beim Anblick des Brennholzes. Sonst hatte sie immer der Mutter zugesehen, wie sie den Ofen angeschürt hatte und beim Kohle auflegen helfen dürfen. Nun schaffte es Emelie unter großer Mühe, ein kleines, aber immerhin loderndes Feuer zu entfachen. – Die beiden sahen dem Farbenspiel zu und Emelie hörte im Inneren die Stimme ihrer Mutter, wie sie die Kinder vor einigen Stunden aufgefordert hatte, Brennholz zu sammeln. – Nie wäre es Emelie in den Sinn gekommen wegzulaufen, wenn sie geahnt hätte, was geschehen würde.
Florentine streckte ihre kleinen Hände näher ans Feuer, um sie aufzutauen. Nachdem sie einige Minuten so verharrt hatte, raschelte es und Fritz trat hervor. Er war in Emelies Alter und hatte im Nachbarhaus mit seiner Familie gelebt. Fritz hielt ein Tuch auf das rechte Ohr. Florentine wollte ihn fragen, was mit seinem Ohr sei, doch Fritz reagierte nicht. – Wie auch. Durch eine Druckwelle war Fritz auf beiden Ohren taub geworden und blutete, wenn mittlerweile auch nur noch sehr schwach aus dem rechten Ohr.
Emelie meinte begriffen zu haben, was los war und machte Fritz mit einer übertriebenen Geste klar, dass er sich zu den Geschwistern ans Feuer setzen sollte. Ohne auch nur einen Ton zu sagen, starrten die Kinder in das kleine, schützende Feuer. Das Knistern des brennenden Holzes, das Heulen des Windes und die beißende Kälte machten die ganze Atmosphäre schaurig und von Einsamkeit erfüllt.
Keines der Kinder wusste, wie lange sie schon so da saßen, jeder in seinen Erinnerungen schwelgend und in sich vergraben. Es störte auch keinen, als noch die beiden Bäckerkinder, Luis und Ellen, beide in je zwei große Decken gewickelt, näher kamen und sich ohne ein Wort zu sagen zu den anderen setzten und mit ihnen ihre Decken teilten.
Stumm flossen Tränen, ängstlich nahmen sie sich in den Arm, um da zu sein. — Auf einmal wurde es hell am Himmel, ein Stern war verglüht und als Sternschnuppe vom Himmel gefallen. Florentine hatte es als Erste gesehen und ihren staunenden Blick nun dem Himmel zugewandt. Auch Emelie und die anderen ließen ihre Aufmerksamkeit dem Himmel zu Teil werden. Schon nach einigen Sekunden folgten drei weitere Sterne dem Vorläufer und fielen als Sternschnuppen vom Himmelszelt herab. Das wortlose Staunen wurde zu guter Letzt mit zwei kleineren, aber nicht weniger imposanten Sternchen abgerundet.
Ellen, Luis und Emelie hatten ihren Blick noch immer nicht vom Firmament abgewandt, als Fritz seine Mundharmonika herauszog und vorsichtig einen ersten, leisen Ton darauf spielte. — Er spürte die Schwingungen des Tones an seinen Lippen und entsann sich daran, wie sich die Lieder immer angefühlt hatten.
Beim Klang dieser Töne verstummte sogar der Wind und ließ die Funken am Himmel zart und glänzend erscheinen.
Es erklang eine Melodie, die jeder kennt; ein Lied, gewidmet den beiden jungen Eltern, deren Sohn das Licht der Welt in einem Stall erblickt hatte.
Fritz hatte schon eine Strophe gespielt, als Emelie leise begann mitzusummen. … Es dauerte kaum eine weitere Strophe, bis auch die anderen auftauten und zu den lieblichen, warmen Tönen der Mundharmonika sangen:
„Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute hoch heilige Paar, holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruh, - schlaf in himmlischer Ruh …"
So sangen sie und nahmen sich in den Arm, bis alle eingeschlafen waren, alle außer Florentine. Sie blickte zum Himmel und sagte leise: „FROHE WEIHNACHTEN!!“ Dann schlief auch sie ein.
August 1969 – Ein kleiner Schritt oder Die Mauer!
Ein strahlender Himmel, eine lachende Sonne und ein duftendes, grünes Feld, in dem zwei Kinder lagen und in den Himmel starrten. Paule und Ina genossen nur nach außen die warmen Strahlen der Sonne, im Inneren mussten sie immer wieder daran denken, was nun in einigen Tagen über ihre komplette Zukunft entscheiden würde.
Gestern Abend hatten ihnen die Eltern noch einmal eingebläut, dass sie mit niemandem darüber reden dürfen. Auf einmal stand Paule auf und als ob Ina wusste, wohin er wollte, lief sie hinter ihm her, sie hörte den murmelnden Bach am Rande des Feldes und das fröhliche Rufen der Kinder, die ihre Ferien genossen und in dem kühlen Wasser spielten. – Wie gerne hätten auch Ina und Paule so nichts ahnend am Bach gespielt; doch damit war es nun vorbei! Die Kindheit mussten sie vergessen, ihr Leben selbst in die Hand nehmen, um ihren Eltern so viel Last, wie nur möglich, abnehmen zu können.
Sie waren angekommen, wie ein weißer unscheinbarer Faden, hatte sie von weitem ausgesehen – friedlich, ruhig und an manchen Stellen mit bunten Flecken „geschmückt“, doch gab es mehr als genug Schauergeschichten, über das, was hinter dieser Mauer lauerte! – Viele der Großeltern und auch der Eltern hatten hinter ihr schon ihr Leben gelassen – ein hoher Preis, den viele für ihre Freiheit bereit waren zu zahlen - morgen, ja morgen wäre es nun auch für sie soweit. Paule ließ einen Finger langsam über den Putz der Mauer streifen, harmlos, ruhig und eben wie eine Hauswand und doch spürte er, was dahinter auf sie lauern würde! – Nie würde es gut gehen, das heute wäre sein letzter Spaziergang mit Ina und seine letzte Nacht, bevor er nie wieder erwachen würde.
Eine kleine Wolke, nur ein Streifen, hatte sich vor die Sonne geschoben, ein Schatten huschte über die Landschaft, für eine Sekunde glaubte Ina, die Zeit würde still stehen, doch kaum war die Wolke verschwunden, rannte die Zeit weiter.
So liefen Paule und Ina noch eine Weile hintereinander her, bis sie an einer Stelle angekommen waren, die von weitem ausgesehen hatte wie ein dichtes, schwarzes Graffiti, doch nun, als sie näher herangekommen waren, bemerkten sie, dass es kein Graffiti, sondern ein Loch in dieser sonst so massiv wirkenden, mitten in der Landschaft stehen Wand war; nicht gerade groß, aber Ina, Paule und ihre Geschwister müssten hindurchpassen. - Aber was sollte aus ihren Eltern werden? - Auch Paule ließ seinen Blick nun über die Mauerwand streifen; dabei entdeckte er eine andere Stelle, an der ein paar Steine vor der Mauer lagen, Paule beschleunigte seinen Schritt und verlangsamte ihn sogleich wieder, als er ein dumpfes Geräusch wie von schweren Schritten hörte, so unauffällig wie möglich, lief er an den Backsteinen vorbei, sie waren nicht sehr groß, aber es könnte langen, um sich auf die nicht all zu hohe Mauer hieven zu können, er lief unauffällig in Inas Richtung zurück und auf dem Weg begegnete er einem russischen Soldaten, der keine 10 Meter hinter ihm gewesen war; nun war ihm auch klar, woher die schweren Schritte stammten. Als er wieder auf Inas Höhe angelangt war, machte sie ihm klar, dass sie den schönen Sommerabend genießen wollte, schließlich konnte es ihr letzter sein, die beiden setzten sich unter eine Trauerweide, in der Nähe des Weges und versuchten, die letzten Sonnenstrahlen der allmählich untergehenden Sonne zu genießen, doch Ina fand keine Ruhe, auf einmal hörte sie Rufe von Kindern, ihr Blick streifte ein paar Kinder, die in der Hocke saßen und anscheinend etwas zu fangen versuchten, doch was war das, das die Kleinen so amüsierte? Das Gras vor den Kindern bewegte sich, Ina konnte sich schon denken, dass die Kinder hinter einem Kaninchen her waren. Es schlug einen Haken, rannte auf die Trauerweide zu, schlug einen weiteren Haken und verschwand unter den Wurzeln einer alten Eiche, trotz allem musste Ina jetzt schmunzeln, als sie die ratlosen Gesichter der Dorfkinder sah. Sie hatten unmöglich sehen können, wohin das Kaninchen verschwunden war, die Kinder sahen sich noch eine Weile um und gingen dann wieder zurück ins Dorf.
Nun war auch Paules Interesse geweckt, er stand auf und lief langsam auf die Eiche zu. Unter einer der Wurzeln war ein zwei Handflächen großes Loch; Ina beugte sich hinunter und raschelte mit ihren Fingern im Gras. In der Höhle begann sich etwas zu bewegen, eine kleine Hasennase kam zum Vorschein, das Kaninchen schnüffelte einen Moment und wagte sich dann heraus. Es war ein ganz liebes, zahmes Tier, das sich sogar streicheln ließ. Ein zartes Lächeln zeichnete sich auf die Gesichter der beiden Jugendlichen, das Häschen hatte ein buschiges, dichtes cremefarbenes und weißes Fell und schöne glänzende tief schwarze Augen; es begann um Ina herumzuhoppeln und ließ sich von Paule kraulen.
Die Sonne war schon tiefer gesunken und der Himmel orange und rot gefärbt, als würde der Maler eine friedliche Welt darstellen wollen.
Ina machte Paule darauf aufmerksam, dass sie so langsam wieder nach Hause sollten, da es noch viel zu tun gäbe. Ina nahm das Häschen auf den Arm und lief mit Paule los, wieder in Richtung Mauer - es war ganz still, man hörte keine Vögel, noch nicht einmal das Rauschen des Baches war zu vernehmen, drei Raben flogen recht tief und bedrohlich, laut schreiend über die Kinder und die Mauer hinweg, sie waren bestenfalls zehn Meter von der Mauer entfernt, die im Licht der Dämmerung in einem bedrohlichen grau erschien.
Der kleine Hase auf Inas Arm wurde unruhig und begann zu zappeln, Ina konnte ihn nicht länger halten und so sprang der Hase auf den Boden; Paule wollte ihn aufhalten, doch der Hase war zu clever, um sich fangen zu lassen. Das Kaninchen sprang direkt auf das Loch in der Mauer zu, Ina warf sich der Länge nach hin, doch sie bekam das Tier nicht zu fassen; aus Angst, dem Häschen könnte etwas passieren, raffte Ina sich auf und hechtete auch durch das Loch und Paule hinter ihr her. Ina hatte so viel Angst um das Kaninchen, dass sie die Soldaten hinter der Mauer nicht wahrnahm und nur hinter dem Häschen her, auf die andere Seite eilte.
Ihre Ohren nahmen zwar wahr, dass hinter ihr etwas zu Boden fiel, aber sie war nicht fähig, es auch zu realisieren. Erst als sie auf der anderen Seite angekommen war und sich nach Paule umdrehen wollte, hörte und realisierte sie einen lauten Knall, der von einem der Soldaten kam, ein lauter Schrei und ein weiterer dumpfer Schlag bahnten sich ihren Weg durch die Stille. Langsam, wie in Zeitlupe, drehte sich Ina um; sie erschrak, der Anblick war schrecklicher als alle Bilder, die sie sich bisher vorgestellt hatte, Paule war gefallen und hatte die Aufmerksamkeit der Wachen auf sich gezogen, als er aufstehen und weiter rennen wollte, traf ihn ein Schuss ins Bein. Ächzend vor Schmerzen fiel er zu Boden und hielt sich das Knie, warum hatte man auf ihn geschossen, er war doch ein Kind, was hatte er verbrochen? Der Schmerz, die Trauer und die Gewissheit, dass nun alles vorbei sein würde überfluteten ihn und er war ohnmächtig dagegen. Nichts und niemand konnte ihn mehr retten, er spürte die Erschütterungen der Erde, welche von den harten Schritten des Soldaten kamen, der auf ihn zu lief.
In vollständiger Uniform mit starrem Blick und finsterer Miene schritt er gefühllos auf Paule zu. Die kleine Hoffnung, die er gehabt hatte, von diesem Mann Hilfe zu bekommen, schwand schlagartig, als der Soldat die Waffe ein zweites Mal anlegte und feuerte.
Für den Bruchteil einer Sekunde war es ganz warm, dann spürte Paule seine Beine nicht mehr, es wurde schwarz um ihn herum und er schwand dahin in den ewigen Schlaf.
Ina wollte schreien, doch sie konnte nicht, ihr Hals war wie zugeschnürt und ihre Zunge wie betäubt, heiße Tränen liefen über ihr erstarrtes Gesicht, sie war nicht mehr fähig sich zu bewegen, ihr Blick heftete sich an Paules Körper, der mitten auf dem Gelände lag; keiner der Soldaten sagte etwas, keiner verzog das Gesicht und niemand war bereit, dem Jungen zu helfen.
Wie gerne hätte Ina geschrien und getobt, nur um sich Luft zu machen, doch als der Wachmann, der Paule erschossen hatte, seinen Kopf zur anderen Seite wendete, wurde ihr klar, dass dies ihr Todesurteil sein würde. Sie drehte sich um, schlüpfte unter einer Plane hindurch, schnappte den wiedergefundenen, verängstigten Hasen und begann zu rennen, immer weiter und weiter, gegen die Zeit und gegen ihre Gedanken. – Nichts und niemand sollte sie daran erinnern, was nun geschehen war und was noch alles geschehen würde.
Nach Inas Empfinden war schon eine Ewigkeit vergangen, als sie sich endlich an einer Hauswand auf den Boden fallen ließ und mit dem Hasen im Arm begann, sich in den Schlaf zu weinen.
Als sie am nächsten Morgen erwachte, fand sie sich in einem großen Zimmer wieder, mit hellen Wänden und einem großen Bett. Neben ihr am Bett saß eine etwas ältere Dame und lächelte sie an: „Na, bist du endlich wach? Hier hast du frische Kleidung. Ich habe dich heute Nacht gefunden, als du am Rande der Stadt geschlafen hast. Mit dem Hasen im Arm und deiner schmutzigen Kleidung, dachte ich mir, dass du dich über ein richtiges Bett freuen würdest, wenn du möchtest, darfst du hier bleiben …“
Ina war verwirrt, wer war diese Frau … sie dürfte hier bleiben? So richtig wohnen? Sie sah das schöne Kleid an, das am Fußende lag und dann wieder die freundlich, dezent lächelnde Dame. - Sie musste träumen, das war die einzige plausible Erklärung. Aber selbst wenn sie träumte, dieser Traum war so schön und schien glücklich weiter zu gehen, sie würde ihn weiter träumen oder hier weiter leben.
So stand Ina auf, nahm das Kleid, zog es an und ging mit der Frau hinunter in einen großen Saal, wo auch drei andere Kinder saßen, die vor vier Wochen aus ihrem Dorf auf der anderen Seite verschwunden waren, alle gut gekleidet und fröhlich. – Nie würde sie ihre Eltern oder Paule vergessen, aber hier begann nun ihr neues Leben und das galt es jetzt zu beginnen.
Und wer weiß, vielleicht würde sie ihre Eltern und Geschwister irgendwann wieder sehen?
-Ende-
Sternenspritzer als Radium!
Grau in grau, ein normaler Schultag. Chemie, Latein, Religion, Biologie, Mathematik, Englisch und später der Höhepunkt des Tages! 90 Minuten Theater AG!
- Nun sitze ich seit sage und schreibe zehn, mir ewig lang erscheinenden, Minuten im Chemieunterricht. Unser Lehrer bemüht sich der Klasse etwas über Radium beizubringen. Während er mit seinen Ständig quietschenden Schuhen vor der Tafel auf und ab „hampelte“ und die typischen Eigenschaften von Radium anschrieb, versuchte ich mich auf irgendeine Weise wach zu halten. –Leichter gesagt, als getan. Seit die einseitig interessierte Diskussion über Radium und seine Eigenschaften begonnen hatte, hing ich immer mehr einem alten Lieblingsfilm hinterher. –Nicht ganz der Geschmack meiner Altersklasse, aber besser einen ganz eigenen Geschmack als gar keinen zu haben.
-Radium, Element oder Verbindung, Lösung oder Feststoff, ist doch egal. – Deutsch, Religion, Gemeinschaftskunde – alles besser als eine einzige Minute länger hier drinnen bleiben zu müssen!
- Wow, unser Lehrer hat bemerkt, dass die Tafel voll geschrieben ist und wirft die Kreide in den Mülleimer, der so voll ist, dass man es nicht klappern hört.
Auf einmal stand ich in der Mitte einiger - ja was waren das, denn? - einiger kreischender Teenys.
Alle hatte komische Kleidchen an und handgelegte Dauerwellen, ich musste lachen… da fühlte man sich ja fast in die 60er zurück versetzt, albern, ich konnte mir das lachen nicht mehr verkneifen und blickte ausweichend zu Boden. AHH!! Was war das? Ich hatte tatsächlich grau-schwarze Sandalen mit Schleifchen an; wo waren meine Turnschuhe, meine ausgelatschten auseinander fallenden Lieblingsschuhe. -Ich blickte einmal komplett an mir hinunter und musste mit erschrecken feststellen, dass ich genauso wie der Rest in einem Kleid steckte, ein graues mit weißen Punkten und einer Schleife.- Grau… überhaupt hier war alles nur Schwarz weiß und grau… komisch.
Ich musste verrückt geworden sein- unglaublich- aber wahr.
Von der Euphorie der anderen „Mädchen“ mitgerissen hüpft - rannten wir über eine Art Schulhof. Dem Getuschel einiger entnahm ich, dass wir auf dem Weg zu einer Jungenschule wahren.
- Jungenschule? –Schwarz, weiß, Kleidchen, Schleifen und… tatsächlich vor uns zwei Knaben der Oberprima, die im Anzug steckten und uns die Tür zum Chemiesaal aufhielten. –Das konnte jetzt nicht wahr sein. In mir begann es zu arbeiten.
„Das ist aber sehr nett von dem Herrn Lehrer, dass wir am Chemie-unterricht der Knaben Oberprima teilnehmen dürfen“, sagte ein Mädchen aus der Runde als wir in einen sehr altmodischen Chemiesaal mit Holztischen und festen Bänken eintraten. Ich platzierte mich mit der „Klasse“ wie ich annahm, in den mittleren Bänken, neben dem Mädchen das eben gesprochen hatte.
Mein Blick streifte über die Lehre Tafel, über das Pult und ich erkannte einiges wieder. –Nicht aus meinem Chemieunterricht, nein, aus einem Film. Meinem Lieblingsfilm.
„Habt ihr denn keinen Lehrer?“, fragte meine Nachbarin.
„Doch, doch… der wird sicher gleich kommen“, meinte einer der Knaben gelassen.
Es dauerte keine fünf Minuten, da begannen alle zu tanzen und zu albern. Selbst mich riss es mit, wie in meinem Lieblingsfilm… es fehlte nur noch die Hauptfigur…
Auf einmal ging die Tür auf und ein Mann im Anzug mit Büchern unter dem Arm und einem kleinen Bärtchen kam herein. Alle zuckten zusammen und wir eilten kreischend auf unsere Plätze zurück.
„So wo sind wir denn gestern stehen geblieben. Ach ich wes, heute machen wir was übers Radium. Wat is en Radium?“, fragte der angebliche Lehrer, sichtlich bemüht uns alle zu übertönen, da wir lauthals zu lachen begonnen hatten.
„Aber das ist doch Pfeiffer!“, hatten alle gerufen.
In der Tat. Vor uns stand Heinz Rühmann in einer seiner besten Rollen, in meinem Lieblingsfilm „Die Feuerzangenbowle“.
Er lies die Vorhänge zu ziehen und hielt gerade zwei riesige Wunderkerzen (Sternenspritzer) in den Händen als es klopfte. Ich wusste ja schon wer da kommen sollte und tatsächlich. Ein älterer Herr trat herein, der Schulrat, und mit ihm das gesamte Kollegium der Knabenschule. –Wie im Film wurde eine Lehrprobe veranstaltet. Doch ich beobachtete nur Heinz Rühmann. Mir war es nicht wichtig, was geschah, mir war wichtig, dass ich hier saß. Leibhaftig einen solchen Schauspieler vor mir sehen konnte.
Ich war so gerührt dass mir Tränen über das Gesicht liefen. Nie hätte ich es für möglich gehalten ihn einmal zu treffen, sein Gast zu sein, nicht einmal als kleines Mäuschen in seinen Filmen und nun hier.
Ich atmete den Duft der abgebrannten Sternenspritzer ein und diesen typischen Geruch nach alten Holzbänken.
Toll einfach toll.
„Marina, ist dir nicht gut?“, mein Chemielehrer stand auf einmal vor mir, „sollte dir nicht gut sein darfst du gerne an die frische Luft gehen.“
„Nein es ist alles in Ordnung!“, versicherte ich schnell und wischte mir die Tränen aus dem Gesicht.
„Nun, dann wirst du uns wohl sagen können was denn nun Radium ist?“
„Radium… nun… ähm… Wenn man Heinz Rühmanns Auslegung aus der Feuerzangenbowle glauben würde, währen es Sternenspritzer!“, ich grinste und mein Lehrer sah mich seltsam an. Im selben Augenblick ertönte der Gong und die Stunde war beendet.
Während ich meine Sachen zusammen räumte kam mein Lehrer zu mir und meine: „Ein sehr toller Schauspieler der Heinz Rühmann. Hätte ihn früher gerne einmal getroffen. Sehr schade dass er nicht mehr lebt.“
„Ich habe ihn getroffen! Vor nicht mal ganz zehn Minuten!“, antwortete ich meinem äußerst erstaunten Lehrer und verließ den Chemiesaal.
!!JUDEN SIND AUCH MENSCHEN!!
Dienstag 9. Juli 1352
Es war noch früh am Morgen, als Christian erwachte. Er hatte nicht vergessen, welche Aufgabe ihm sein Vater gegeben hatte. Christian sollte heute in den Wald gehen und frische Wurzeln und Kräuter für die Apotheke besorgen. So stand er ganz leise auf, zog sich an und schlich aus dem Haus.
Mit einem Weidenkorb seiner Mutter ging er geradewegs auf den Wald zu, der hinter der Stadt lag. Es war ein langer Weg. Er musste durch die noch verlassenen Handwerkerviertel und schließlich kam der Junge in die Viertel der “Unbeliebten“. Ihm war ein wenig mulmig zumute, als er durch diese Gegend lief. Man erzählte sich so viele Schauergeschichten über die Bewohner, doch wenn man sie eine Weile beobachtete, sah man, dass sie sich wie ganz normale Bürger verhielten. Christian war der festen Überzeugung, dass auch die Nichtbürger ein Recht auf Freiheit haben sollten.
Nun kam der Knabe an den Rand des Waldes und begann nach den benötigten Kräutern zu suchen. Also, was brauchte er noch einmal?: Salbei, Hopfen, Efeu und natürlich auch noch Engelwurz. Aber dazu musste er zu dem kleinen Bach am anderen Ende des Waldes gehen. Deswegen lief er zügigen Schrittes zu seinem Ziel. Er war soeben dort angekommen, als er ein seltsames Schluchzen hörte. Christian wollte sich gerade umdrehen, als plötzlich ein Mädchen vor seinen Füßen lag. Während er ihr aufhalf, fragte er sie: „Wo kommst du denn auf einmal her, was machst du hier? Warum weinst du?" „Warum willst du das wissen?" „Ich habe ja nur gefragt, da du aus heiterem Himmel aufgetaucht bist", erwiderte Christian knapp. „Weil ich das gerade dir sage, du bist doch genau so schlimm wie die anderen Bürger der Stadt!" „Wieso, was hast du gegen die Bürger der Stadt? Du kommst doch auch aus der Stadt, oder etwa nicht?" Das Mädchen antwortete: „Ihr wart es doch, die uns beschuldigt hatten, die Pest gebracht zu haben. Obwohl viele von uns genauso an der Pest gestorben sind wie ihr! Meine Eltern nämlich auch." Sie fing an zu weinen. Christian nahm sie daraufhin in den Arm und fragte: „Bist du etwa Jüdin?" Sie erwiderte: „Ja!" Der Junge wollte sie beruhigen: „Ich habe nichts gegen Juden, sie sind genau solche Menschen wie die freien Leute." Das Mädchen hörte auf zu weinen: „Ehrlich?" „Ja! Wie heißt du denn?" „Mia und du?" „Christian. Aber du trägst ja gar keinen gelben Fleck?" „Den habe ich verloren." „Hier im Wald?" „Ja", antwortete Mia. Daraufhin meinte Christian: „Was machst du überhaupt hier im Wald?" „Ich bin auf der Flucht! Die haben vor, uns aus der Stadt zu werfen, deswegen wollen meine Geschwister und ich uns einen Platz suchen, wo wir in Sicherheit sind. Aber ich habe sie unterwegs verloren und will sie wieder finden." „Ja sag mir, wo wollt ihr denn hin, im Reich nimmt euch doch keiner auf?" „Wir wollen auswandern, aber dann waren plötzlich meine Geschwister verschwunden." „Du kannst dich hier im Wald verstecken, ich komme heute Nachmittag und bringe dir etwas zu essen und dann helfe ich dir, deine Brüder zu finden. Aber sag, wo wollt ihr eigentlich hin? Alle Städte in der Umgebung haben schon die Verbote aufgestellt, dort seid ihr nicht mehr sicher!" „Wir wollen nach Polen auswandern, das ist zwar ziemlich weit, aber mein Bruder meint, da wäre das Leben viel besser als hier!" „Nach Polen! Da seid ihr ja eine Ewigkeit unterwegs, und durch wie viele Städte ihr da müsst! Seid ihr euch über die Gefahren bewusst, denen ihr euch da ausliefert und von was wollt ihr auf eurer Reise leben?" „Das wissen wir doch jetzt noch nicht! Ich habe Brüder, die alt genug sind, um uns zu versorgen!", sagte Mia mit einem leichten Unterton. „Sei bitte nicht gleich beleidigt! Ich habe mir nur ein paar Gedanken gemacht! Einverstanden?", entgegnete Christian mit ruhiger Stimme. „Ja, ist schon gut. Ich wollte dich nicht beleidigen, das ist nur, wenn jemand etwas gegen meine Brüder sagt, reagiere ich empfindlich!" „Das ist in Ordnung, ich kann dich verstehen!", versicherte Christian.
„Was tust du eigentlich hier im Wald?“, fragte Mia neugierig. „Ich muss Kräuter für unsere Apotheke sammeln! Normalerweise müsste ich mich ja beeilen, aber du bist wichtiger!“ „Ich möchte nicht, dass du wegen mir Schwierigkeiten bekommst! Also gehe lieber!“ „Ich lasse dich jetzt doch nicht alleine hier! Wir gehen jetzt zusammen los und suchen die restlichen Kräuter, dann versteckst du dich im alten Dachsbau, bis ich wieder komme!“ „Ich will mich nicht verstecken, ich will meine Brüder suchen!“, beharrte Mia trotzig.
„Man merkt, dass du so alt bist wie meine Schwester, die ist auch so stur! Das ist nicht um dich zu ärgern, sondern nur zu deiner Sicherheit! Ich verspreche dir auch, dass wir später deine Brüder suchen!" „Na gut! Wo soll ich hin?" Nachdem Christian die Kräuter hatte, gingen sie in die Tiefe des Waldes. Dort befand sich ein verlassener Dachsbau, der früher von den Jungen der Stadt als Versteck genutzt wurde. „So, hier bleibst du bitte, bis ich wieder komme! Und gehe ja nicht aus dem Wald heraus! Ich beeile mich, um zurückzukommen", mit diesen Worten verabschiedete sich Christian von Mia und ging zurück.
Er hatte viel Zeit verloren, weshalb er etwas zügiger lief. Bald war er in den nun belebten Handwerkervierteln, dort verlangsamte er seinen Schritt. Doch er sollte noch von seinem Vater ins Gebet genommen werden. Als er die Tür zur Apotheke öffnete, sah er den Vater hinter dem kleinen Tisch stehen: „Wo kommst du her? Warum bist du so spät dran? Hast du etwa zu lange geschlafen?" „Ich habe nicht zu lange geschlafen, aber ich musste lange suchen, bis ich den Engelwurz und den Salbei gefunden hatte", erwiderte Christian etwas genervt. „Nun, dann gehe und helfe deiner Mutter die Arzneien anzufertigen. Deine Schwester ist auch bei ihr. - Sag, hast du noch Alraunen im Wald gesehen?", bemerkte Herr Quack. „Ich weiß nicht, ob das Alraunen waren, die sahen etwas braun aus!", meinte Christian, während er zu seiner Mutter hinaufstieg. Dort sah er, wie seine Mutter mit seiner Schwester an einem kleinen, mit Kräutern und Gläsern überhäuften Tisch saßen, um einige Cremes herzustellen. Er setzte sich zu ihnen. Und als seine Mutter bemerkte, dass ihm etwas auf der Seele brannte, sagte sie: „Hildegard, geh doch mal nach unten, sieh nach, ob Wilhelm mit allem klar kommt." Nachdem Hildegard den Raum verlassen hatte, wandte sich Frau Quack an Christian und fragte: „Was ist nun im Wald wirklich geschehen? Ich glaube kaum, dass du nur nach Salbei gesucht hast!" Christian antwortet zögernd: „Ich bin zu spät gekommen, weil ich — weil ich — ein Mädchen getroffen habe." „Lass das ja nicht deinen Vater hören! Wie heißt sie denn? Wo wohnt sie denn?" „Das möchte ich noch nicht verraten, aber ich möchte sie unbedingt wieder sehen!" „Das geht in Ordnung, ich brauche sowieso noch einen Kohl für das Abendessen vom Markt!", meinte die Mutter mit einem Lächeln im Gesicht. Mit einem knappen aber herzlichen „Danke" verschwand Christian.
Als Christian nach draußen kam, traf er Martin und Rebecca. Sie wollten gerade in die Apotheke gehen, da fragte Martin: „Wo willst du denn hin? Ich dachte, du musst heute in dem Laden bleiben!“ „Nein! Meine Mutter hat mich fortgeschickt, um etwas auf dem Markt zu besorgen!“, entgegnete Christian schnell. „Also! Ich muss auch schon weiter! Auf Wiedersehen!“ Christian bog um die nächste Ecke und war verschwunden.
So ging er wieder in Richtung Wald. Doch als er am Dachsbau angekommen war, fehlte von Mia jede Spur. Etwas entsetzt begann er nach Mia zu rufen, er konnte nicht verstehen, warum sie nicht in ihrem sicheren Versteck geblieben war. Wo war sie nur? War sie etwa aus dem Wald gegangen? Sicher nicht. Rufend und schreiend lief Christian durch den ganzen Wald. Sah überall nach ihr: An der großen Linde, am Kaninchenbau auf der kleinen Lichtung, aber sie war nirgends zu finden. Als er schließlich am Bach ankam und sie auch hier nicht vorfand, setzte er sich enttäuscht ins Gras und schluchzte: „Warum ist sie nicht hier geblieben? Sie hatte es doch versprochen! Ich dachte, sie würde mir vertrauen! Ich habe mich auf sie verlassen und ich wollte ihr helfen! Und, und was macht sie? Sie rennt einfach in ihr Verderben! So ich gehe jetzt! Ist mir doch egal, was diese Mia tut! Soll sie doch in ihren Tod rennen! Ich werde ihr jedenfalls nicht mehr helfen!" So stand Christian auf, wischte sich kurz übers tränenverschmierte Gesicht und trat den Heimweg an. Im Judenviertel ließ er noch einmal seinen Blick schweifen, aber er erblickte Mia nirgendwo. Er war schon am Schwabentor angelangt, als er sie auf einmal sah. Mia ging mit zwei größeren Jungen auf das Tor zu. Er begann zu rufen: „Mia, warte! Mia!" Mia blieb einen Augenblick starr stehen, dann wandten sich alle zu Christian um und starrten ihn an. „Wo warst du? Ich habe dich überall gesucht!" Daraufhin meinte Mia zögerlich: „Ich konnte nicht untätig im Wald sitzen. Ich musste meine Brüder suchen, ich konnte doch nicht einfach da sitzen und darauf warten, dass ich meine Brüder überhaupt nicht mehr finde!" „Du hättest auf mich warten können, sobald ich da gewesen wäre, hätten wir ja gemeinsam gesucht! Das hatte ich dir doch versprochen!", erwiderte Christian etwas angegriffen. Mia war aber fest davon überzeugt, dass sie das einzig Richtige getan hatte: „Ich musste sie einfach suchen! Ich konnte nicht anders! Deshalb bin ich zurückgegangen." „Ich hatte versprochen, dass ich komme und du, dass du wartest! Ich dachte, wir könnten einander vertrauen!" Nun wurde Mia laut: „Das ging nun mal nicht anders!" Durch Mias lauten Tonfall kamen ihre Brüder heran und fragten: „Was ist denn los, ich dachte wir wollen aufbrechen? Was gibt es denn noch so Wichtiges? Wir müssen vor Einbruch der Nacht im finsteren Wald hinter den nächsten Städten sein!" „Warum müsst ihr eigentlich fliehen, ihr könnt doch hier in der Stadt leben! Und ..." „Und darauf warten, dass man uns von hier verbannt, oder in den Nachbarstädten auf den Scheiterhaufen wirft?? Wir wollen in Frieden und Freiheit leben! Wir haben nichts verbrochen und unsere Eltern sind gestorben! Glaubst du echt, uns hält noch irgendetwas hier in dieser Stadt??", fiel ihm der ältere der Brüder ins Wort. „Das verstehe ich nicht, wenn ihr nichts getan habt, müsst ihr doch auch nicht fliehen! Wie kommt es eigentlich, dass ihr verfolgt werdet?" „Das weißt du nicht? Wohnst unter der Sippe, die uns am liebsten brennen sieht und weiß nicht warum!", meinte der jüngere der beiden Brüder. „Nun sei nicht gleich so ausfällig, er kann ja nichts dafür! Also, alles begann vor vielen Jahren: Du hast wohl schon davon gehört, dass Papst Urban II. zu den Kreuzzügen aufgerufen hat. Damals ist der größte Teil der Bevölkerung losgezogen, um euer heiliges Land zu retten. Doch als sie auf dem Weg waren, kam ein in eine dunkle Kutte gehüllter Mann zu dem Heer und fragte die Männer, ob sie nicht lieber die Leute bestrafen wollten, die ihren Heiland getötet hatten. Dieses Argument hatte auch die gewünschte Wirkung, das Heer zog nicht nach Jerusalem weiter, sondern verteilten sich im ganzen Reich und töteten alle Juden. Daraufhin wurden auch die Kleiderordnungen eingeführt und wir wurden erpresst ....", erzählte der Älteste ruhig, bis ihn Christian unterbrach: „Aber wieso habt ihr denn den Christus ans Kreuz geschlagen?" Da schaltete sich Mia ein und erklärte: „Das waren ja nicht wir, sondern unsere Vorfahren und diese standen unter dem Befehl vom römischen Kaiser! Da hatten sie gar keine andere Wahl! Erzähle weiter Jakob (so hieß ihr ältester Bruder)!" Jakob fuhr fort, als wäre er überhaupt nicht unterbrochen worden: „Als dann auch noch die Pest ausbrach, war das für die Herrscher ein guter Vorwand, alles auf uns abzuwälzen, wie hätten sie es denn sonst dem Volk erklären sollen? So mussten wir Juden eben wieder herhalten. Man warf allen Juden vor, dass sie die Brunnen der Stadt vergiftet hätten. Das stimmte natürlich nicht, denn von uns starben genauso viele, darunter auch unsere Eltern. Als erstes kamen diese komischen Kleiderordnungen, dann hetzten sie uns einige „Schützer" auf den Hals. Das waren Leute, welche die Regierung uns angeblich zu unserem Schutze zur Verfügung stellte, doch in Wahrheit wollten sie nur Geld haben. Als ob das noch nicht langen würde, schoben sie uns zu den Randgruppen ab. Doch der Gipfel von allem ist noch dieses komische Stadtverbot! So nun weißt du die ganze Geschichte, warum wir verfolgt werden. Deshalb müssen wir nach Polen!" Christian wusste nicht genau, wie er nun darauf reagieren sollte, er starrte Jakob noch immer so an wie eben, als er es noch erzählt hatte. Er hatte nie verstanden, warum das alles geschah. Doch nun, als er alles erfahren hatte, lagen ihm die Schuldgefühle wie ein Backstein in seinem Magen. Es tat ihm so Leid, was mit Mias Familie geschehen war. Er wusste zwar, dass er nichts daran ändern konnte, doch er wollte nicht einfach nur hier herumstehen. So öffnete er den Mund und versuchte etwas zu sagen. Zuerst kam kein Laut heraus, doch dann nahm er alle Kraft zusammen und sagte ganz leise: „Das tut mir Leid!" „Dir muss nichts Leid tun! Du hast das ja alles nicht getan! Das waren die Erwachsenen und sie werden auch nicht so schnell damit aufhören!", meinte Jakob.
„Das ist aber ungerecht! Da muss man doch etwas tun können!“, meinte Christian empört. „Da kann keiner etwas daran ändern, außer die, die es tun!“, meinte Mia.
Alle hatten beim Erzählen die Zeit vergessen. Die Sonne stand schon fast am Gebirge, da meinte der jüngere Bruder: „Wenn wir jetzt nicht aufbrechen, brauchen wir überhaupt nicht mehr loslaufen! Lebe wohl!" „Lebe wohl, Christian!", sagten Jakob und Mia wie aus einem Munde. „Lebt wohl! Und du, Mia, vergiss mich bitte nicht!", sagte Christian mit von Tränen erstickter Stimme, während er sie in den Arm nahm. Als die beiden einander wieder losgelassen hatten, liefen Mia und ihre Brüder los. Hinter dem Stadttor drehten sich alle drei noch einmal um und winkten Christian, der dies erwiderte.
Christian blieb wie angewurzelt stehen, bis er die Drei nicht mehr sehen konnte. Eine Träne rann ihm über die Wange, als sie verschwunden waren. Bisher hatte er Tränen für ein Zeichen von Schwäche gehalten, doch dies war ein vollkommen neues Gefühl, nicht zu beschreiben. Ihm war flau im Magen und er spürte seine Knie nicht mehr, was war das nur für ein Gefühl? „Ist das etwa Liebe?“, murmelte Christian vor sich hin.
Er stand noch immer an der selben Stelle wie zuvor, doch jetzt fiel ihm etwas ein! Seine Mutter brauchte noch den Kohl vom Markt! Hoffentlich war es noch nicht zu spät! Er wischte sich die Träne vom Gesicht und rannte los in Richtung Marktplatz. Er hatte Glück, die Händlerin vom Gemüsestand war noch da, sie hatte sogar noch einige Kohlköpfe übrig. So konnte Christian noch das Benötigte für seine Mutter einkaufen. Schnellen Schrittes lief er dann zur Apotheke. Der Vater war zu Christians Glück nicht da. So ging er zu seiner Mutter, gab ihr den Kohlkopf und marschierte ohne ein Wort zu sagen hinauf und setzte sich auf sein Bett. Er versank in Gedanken, dachte noch einmal über den ganzen Tag nach und vor allem aber über dieses merkwürdige Gefühl, von dem er dachte, dass es Liebe sein musste. Nur zu gerne hätte er mit jemandem über das alles gesprochen, doch das war nicht möglich, da es Mia und ihre Brüder in größte Gefahr bringen würde.
„Hallo! Was ist mit dir? Bist du krank?“, seine Schwester stand über ihn gebeugt. Er hatte sie überhaupt nicht gehört. „Sag schon! Was ist mit dir los?“, fragte Hildegard weiter.
„Es ist nichts! Alles in Ordnung!“, entgegnete Christian mit schwacher Stimme. „Nun, dann komm runter, das Essen ist fertig!“, meinte Hildegard fordernd.
Christian stand auf und schlich mit ihr hinunter. Nach dem Abendessen ging er früh zu Bett und versank abermals in Gedanken. Je mehr er über alles nachdachte, desto intensiver wurde dieses merkwürdige Gefühl. Es rumorte in ihm und ein Kloß stieg langsam in seinem Hals hoch. Er spürte, wie seine Augen feucht wurden und dann begann er zu weinen. Er konnte sich nicht erklären, was mit ihm geschah, er wusste nur, dass er so etwas noch nie zuvor gefühlt hatte. Christian konnte an nichts anderes denken und so ließ er den ganzen Tag noch einmal an sich vorüberziehen. Nach einiger Zeit schlief er weinend darüber ein.
----------------------------------------------------------------------------
Hierzu möchte ich noch sagen, dass der Text in der Zusammenarbeit mit meiner besten Freundin Darija entstanden ist, da unser "Geschichtslehrer" mit der gesamten Klasse einen Roman geschrieben hat, der im Mittelalter (Stadt) spielt. Dies war unser Kapitel. ;o)
Jeanne d’Arc
Gefangen im Feuer stand sie da. Sie sah keinen Ausweg mehr und selbst wenn, sie wäre nicht geflohen. Dies war ihr Urteil, der Dank, für das, was sie für das Land getan hatte. Es interessiert keinen, was es bedeutet hier zu stehen, das Feuer zu sehen, wie sich der Kreis immer enger schließt, die Wärme zu spüren, wie sie zur Hitze wird unerträglich, und doch nicht tödlich. Sie stand da, gefesselt, nicht geknebelt, alle wollten hören, wie sie schrie, um Gnade sollte sie betteln, die Töne würden die Leute auf diesem Platz nur berauschen. Nein, das war nicht in ihrem Sinn. Aufrechten Hauptes holte sie noch einmal Luft, dann schloss sie ihre Augen und wünschte dies alles sei nur ein böser Traum und sie läge noch auf der Pritsche in der Folterkammer, wo sie auch die letzten Tage verbringen musste, alles wäre ihr lieber gewesen, als hier stehen zu müssen, nie hätte sie mit so viel Undankbarkeit der Menschen gerechnet. Es stand ihr nicht zu über die anderen zu urteilen. Nein, so wäre sie kein bisschen besser gewesen als der Rest des französischen Volkes.
Sie schloss die Augen und lies das Urteil über sich ergehen. Zwar konnte sie die Anwesenheit ihrer Freunde spüren, doch auch diese waren machtlos gegen das Urteil.
Durch die Hitze wäre sie beinahe ohnmächtig geworden, doch sie kämpfte dagegen an. Sie war im Krieg gewesen — hatte Seite an Seite mit ihren Freunden gekämpft. Ihre Augen hatten hatten schon so viele andere, mächtige, intelligente und schöne Frauen gesehen. Demselben Schicksal ins Auge sehend, stand sie nun da. Sie musste einfach an die Menschen denken, die sie hier angebunden hatten. Wie nur vor wenigen Minuten der Bürgermeister ihr die Frage gestellt hatte, ob sie leben wolle.
Was wäre das für ein verlogenes, feiges Leben geworden? Nein, sie war nicht für das Leben bestimmt. Die ihr auferlegte Aufgabe hatte sie bereits erfüllt. Alles was ihr Leben geleitet hatte, war geschehen. Eine Hausfrau zu werden, Mutter von Kindern und verantwortlich für den Haushalt war nicht ihr Leben.
Geboren zum Sterben und doch ewig Leben. Eine unbedeutende Aufrührerin — vom Staat verachtet — von der Stadt getötet… und doch ewiges Vorbild.
Vor ihrem geistigen Auge erschienen die Szenen, wie sie mit ihrem besten Freund sieben Wochen vor ihrer Gefangenschaft auf dem Kriegsfeld gestanden war. Seite an Seite, mit Schild und Schwert, hatten sie gekämpft, für ein friedvolles und gerechtes Frankreich.
Im Glaube gesiegt zu haben, war sie drei Wochen vor ihre Gefangenschaft zurückgekehrt. Das Heer hatte sie gefeiert, doch beim Anblick des Dorfes bekam sie ein schlechtes Gewissen. Mitten im Dorf lagen Pestkranke auf Tragen, damit sie von der Kälte einfroren und nicht mehr die Schmerzen spüren mussten. Links vor dem letzten Haus lag ein kleines Mädchen, zusammengekauert und von kaltem Schweiß überströmt! Sie hatte die Pest. – Das konnte sie nicht mit ansehen. Sie lief hinüber und setzte sie zu dem Mädchen. Legte ihre Hand auf ihre Stirn und spürte ihre Angst vor dem Tod. Sie nahm sie ihr, indem sie ihr lange in die Augen sah. Ohne sich zu rühren, solange bis sich der Blick des Mädchens beruhigte, die Nerven in ihrem Gesicht entspannten und sie in den ewigen Schlaf fiel. – Ihr Freund hatte sie entsetzte, aber nicht angewidert, angesehen. Dieser Blick genügte um zu verstehen, dass nun alle glaubten, dass auch sie die Pest an sich hatte. Sie schritt zu einem der Fackelträger und hielt ihre Hände, ohne auch nur eine Miene zu verziehen, ins Feuer. Sie rieb sie alle Pest von den Fingern – doch statt der Pest bekam sie nun härteres Brot. Sie wurde für eine HEXE gehalten!
Es war befohlen worden, dass man sich von solchen Frauen fern halten sollte. Der Scheiterhaufen war nun das bett ihres Lebens.
Der Mond hatte nur zwölf Mal gewechselt, doch ihr Leben war ihrer Bestimmung nach verändert worden.
Die Flammen schlugen ihr ins Gesicht. Die Hitze war unerträglich und ihre Haare kräuselten sich schon. Nun war es soweit! Die Hülle von Wut, die ihr Schmerzempfinden ausgeschalten hatte, war nun zerbrochen. Sie fühlte den Schmerz auf ihrer brennenden Haut. Sie bekam keine Luft mehr — und doch lebte sich noch. Mit aller noch irgendwie aufzubringender Kraft rief sie ein letztes Stoßgebet an die heilige Katharina aus. Die gesamte Menge hörte dies, doch keiner war im Stande auch nur ein Wort zu sagen.
Umgeben von Feiglingen, gefangen im Feuer, gebeutelt von Schmerzen holte sie am 30. Mai 1431 ein letztes Mal Luft und rief aus ihrem tiefen, christlichen Glauben ein letztes Mal nach ihrem Erlöser Jesus Christus. — Dann sank ihr Haupt zusammen und war nach wenigen Minuten nur noch in Asche vorzufinden.
Lange konnte die Menschheit nicht erkennen, dann Jeanne keine Hexe, sondern eine Frau war, eine Frau, die wusste was sie tat und für ihr Tun sterben musste. So wurde 1458 das Urteil von Johanna genommen. 1920 wurde sie endlich von aller Schande befreit, indem sie heilig gesprochen wurde.
Zwischen Himmler und Heute
Ziel: Konzentrationslager Struthof (Frankreich)
Zwei Busse voll mit Gymnasiasten, brütende Hitze, wolkenloser, blauer Sommerhimmel. Irgendwann kamen wir an, stiegen aus und liefen zu unserer ersten Station (200 Meter weiter):
ein kleines unscheinbares altes Häuschen mit einer Tür ohne Klinke und ohne Schloss, die zweite hatte sowohl Schloss als auch Klinke und über dieser Tür hing ein großes Schild, das leider nur auf Französisch beschrieben war, doch unser Lehrer ließ uns nicht lange im Ungewissen, es handelte sich um die „Gaskammer“.
Allerdings nicht um eine, wie wir sie aus Auschwitz oder anderen KZs kannten. Das Häuschen hatte anfänglich als Winterspeisesaal gedient, da das kleine Gasthaus nicht genug Platz hatte, um alle Wintersporttouristen unterzubringen. Später dann, als das KZ auf dem Berg von Kramer geleitet wurde, machte man daraus einen Speisesaal für SS Bedienstete. Herr Behne war nicht zum ersten Mal hier und das spürte man auch, wenn man ihm beim reden zuhörte, er erzählte seine Informationen nicht monoton und abgestumpft, sondern wartete auf Ruhe, damit er so viele wie möglich erreichte.
Mir war komisch zumute, als wir dann durch den Wald hinaufliefen zu dem eigentlichen Konzentrationslager. Wir liefen hier auf dem Boden, den vor einigen Jahrzehnten Leute gelaufen waren, die unter unwürdigsten Bedingungen hier gehalten worden waren.
Es war unglaublich und einfach nicht begreifbar, mit einem einfachen Menschenverstand. Dieser Waldboden, auf dem so viele Hirschhornkäfer krabbelten, dieses Singen der Vögel, all das war auch damals schon hier gewesen. Mitunter wird es im Sommer sogar so herrliche Tage gegeben haben wie den heutigen.
Schließlich kamen wir auf dem steil ansteigenden Waldweg zu einer kurzen Zwischenstation. Wir standen vor der Villa von Kramer, dem Leiter des Konzentrationslagers Nazweiler-Struthof. Es war eine alte Villa mit einem Garten und einem Swimmingpool. Herr Behne erzählte uns, dass Kramer ein eiskalter KZ Leiter gewesen sei, aber von seiner Familie und seinen beiden Kindern immer als liebevoller, fürsorglicher Vater beschrieben wurde. Bei diesen Worten begann etwas ganz tief in mir zu rumoren. Nach ein paar weiteren Worten gingen wir weiter. Die Straße, die wir überquert hatten, war von den Gefangenen dieses KZs gebaut worden, jeden Tag haben sie daran gearbeitet, bei der größten Hitze, bei bitterer Kälte – immer.
Auf einmal standen wir auf einem Platz, auf einer Anhöhe. Vor uns das Eingangstor zum KZ-Platz. Man konnte hier überall die Baracken anschauen und rechts davon stand ein gigantisches Mahnmal, in das ein Mensch eingelassen war. Nach einer kurzen Toilettenpause gingen wir hinein. Es war ein komisches Gefühl, dieser alte Stacheldraht, die Wachtürme, die Baracken und so viele bunte Schüler, die ohne zu begreifen hier herumstiefelten. Einigen konnte man buchstäblich ein „Mensch ist das öde, ich will endlich nach Hause“ von der Stirn ablesen.
Herr Behne erzählte uns, wofür welche Baracke gedient hatte und wies außerdem darauf hin, dass die roten sandigen Flächen die Stellen markieren, an denen damals weitere Baracken gestanden hatten, die aber von der Feuerwehr entfernt wurden, weil sie mit dem Ungeziefer darin nicht mehr zu retten waren.
Während wir weiterliefen, schlurften alle mit ihren Schuhen, es kam mir falsch vor, hier so viele Geräusche zu machen und ich lief so leise ich nur konnte. - Die Sonne wurde immer heißer und erbarmungsloser, die Tatsache, dass wir innerhalb des Lagers nichts trinken durften, machte die Sache nicht erträglicher.
- Wie unpassend, während ich an meine Wasserflasche in meinem Rucksack dachte, berichtete unser Lehrer, dass die Insassen am Tag nur ein paar wenige Scheiben Brot und einen Liter Wassersuppe bekamen, was noch nicht mal der Wahrheit entsprach, da die Austeiler nicht selten die Lebensmittel gegen ein paar Zigaretten eintauschten und somit andere um ihre Rationen brachten.
Nacht- und Nebelaktionen standen hier an der Tagesordnung, Häftlinge wurden mitten in der Nacht in das Lager gebracht, wurden, ohne dass sie jemand kannte, am nächsten Morgen hingerichtet. Nicht selten wurden Männer in den Graben geschmissen und wenn sie dabei eine so genannte Todeslinie überschritten, wurde dies als Fluchtversuch gewertet und die Männer wurden aus den Türmen erschossen. Jeder der acht Wachtürme, die das Gelände umsäumten, war damals mit einem Maschinengewehr ausgestattet. Wärter, die einen Fluchtversuch verhinderten (in dem sie Männer erschossen) wurden mit extra Rationen und zusätzlichen Zigaretten belohnt.
Herr Behne erzählte uns von einigen gelungenen und misslungenen Fluchtversuchen, wobei es nur vier Leute geschafft hatten, wirklich aus dem Schreckenslager zu entkommen.
Nun standen wir am untersten Teil des Lagers vor zwei noch stehenden Baracken. Die eine wurde bei den Insassen nur Bunker genannt, weil dort hinkam, wer innerhalb des Lagers etwas Verbotenes getan hatte. Die andere stellte das Krematorium dar, in dem auch Versuche an den Häftlingen durchgeführt wurden, was am Ende sogar dazu führte, dass eine Seuche im Lager ausbrach.
Ich stand vor diesem Brennofen und mich durchfuhr ein eisiger Schauer, gerade noch war mir so heiß gewesen und jetzt hier drin sehnte ich mich nach einer dicken Daunenjacke… Zwischen Bunker und Krematorium war eine Grube mit einem Kreuz als Gedenkstätte.
Ab und an liefen an uns ein paar ältere Männer mit ihren Söhnen und Enkeln vorbei, die erzählten und schwiegen, ihre Blicke hatten etwas Würdiges und dennoch fixierten sie einige Punkte auf dem Gelände mit verachtenden und ängstlichen Blicken, man konnte ihnen deutlich ansehen, dass es Überlebende dieses Schreckens waren. Doch für uns ging es weiter, mittlerweile wieder in der großen Mittagshitze. Hoch am Galgen vorbei in die erste Baracke, die heute als Museum dient. Im Museum war es mehr ein Bilder betrachten und Sinn erraten, da unsere Französischkenntnisse entweder nicht vorhanden waren oder bei weitem nicht ausreichend waren. Doch die Bilder von den klapperdürren oder total entkräfteten Häftlingen und den protzigen und machtversessenen Wärtern waren auch ohne Französisch sehr einprägend und nicht einfach aus dem Gedächtnis zu streichen. Ich stand still vor Kramers Bild, sah auf die Augen und sah nichts, kein Gefühl, nichts mehr von dem liebevollen Familienvater, nur noch den kalten skrupellosen Mörder, der am Ende sogar noch sagte, dass er seine Befehle hatte, an die er sich halten musste. Ich hatte ein undefinierbares Gefühl im Bauch, es war etwas zwischen Wut und Hilflosigkeit. – Fast unmittelbar neben Kramer hing ein Bild von Himmler, der in meinen Augen eher noch ein Stück schlechter als besser war. Bonhoeffer hatte einmal gesagt, es sei besser, Böses zu tun, als böse zu sein. – Bei den beiden bin ich mir nicht wirklich sicher, ob der Satz auf die positive Seite anzuwenden ist… Irgendwann hatte ich einen Punkt erreicht, an dem ich einfach nicht mehr die Bilder sehen konnte, ich musste hier raus, weg.
Weit weg war nicht möglich, aber zumindest raus aus dem Museum und vor der anderen Baracke im Schatten sitzen.
Es war das dreisteste Paradoxon, das mir je begegnet war. Ich saß hier in einem der schlimmsten Vernichtungslager, die man sich überhaupt nur ausmalen konnte und wenn man sich umsah, entdeckte man eine Landschaft so herrlich und schön. Berge und Täler, verschiedene Farben der Wälder und das Singen der Vögel, das man überall hören konnte. Mein Blick fixierte den Strick am Galgen, der sich in der Hitze zu bewegen schien.
Auf einmal konnte ich mir es richtig vorstellen, früh morgens, bei jedem Wetter, wie alle antreten mussten, Alte, Kranke, Schwache… wie einfach alle aus ihren Baracken gezerrt worden waren und da standen, noch bei der Hinrichtung eines Häftlings zusehen mussten und so grausam das alles doch war, es war der Alltag all derer, die hier leben mussten. Da fiel nicht mehr jeder Blick trauernd auf den Galgen, hier ging es um das pure Überleben; So langsam konnte ich verstehen, was mit den Worten "Hier drin überlebte nur, wer einen Freund und etwas Brot hat" gemeint war.
Plötzlich wurde ich aus meinen Gedanken gerissen und war wieder neben meinen zahlreichen Jahrgangskameraden, irgendjemand hatte etwas von einer Gummipalme gesagt, taktlos, klar. Aber wenn man sich umsah und bedachte, wie viele Jahre zwischen uns Jugendlichen und dem Schrecken von damals lagen, war es irgendwo auch wieder verständlich, dass sich das ganze kaum einer vorstellen wollte und/oder konnte.
Für mich war es wie eine Befreiung, endlich aus diesem eingezäunten Gelände zu gelangen, ein letzter Blick auf den, damals mit Menschenasche gedüngten, Gemüsegarten und dann waren wir endlich erlöst und konnten uns auf die Suche nach unserem Bus machen.
Was ich von diesem Tag behalten habe, außer einem ziemlichen Sonnenbrand? Einiges, und ich finde es sehr wichtig, dass solche Fahrten weiter unternommen werden, denn die Erinnerung an diesen Schrecken, die Bilder von Kramer und Himmler, die Blicke und die unvorstellbaren Zahlen von Toten, die dazu gehörten, das war und ist etwas, das uns daran hindert, unseren Mitmenschen das selbe noch einmal anzutun, denn die Erinnerung ist hier eine wichtige Schranke.
Gedanken, die im Regen fallen
Ein Regentropfen fällt herab. Er zeigt das weinende Gesicht des Himmels. Weinend über Leid und Hass auf Erden. – Der Hilflosigkeit des Universums, nur weil es die Aufgabe hat, zu sein, wie es ist. – Ist das eine Rechtfertigung?
Ist es wirklich die Vorbestimmung, die uns in unseren Rahmen zwängt? Jeder Schritt, jeder Atemzug die Folge eines Programms, das mit unserem ersten Augenaufschlag begann und mit unserem letzten Atemzug enden wird?
Ein weiterer Tropfen fällt und trifft meine Hand. Ich schaue auf, sehe in die Blätter des Baumes über mir. Ein weiterer Tropfen trifft ein Blatt, es federt wie ein Trampolin, er rollt und fällt herab. – Ich erhebe mich, laufe los. Mittlerweile regnet es richtig, meine Kleidung wird nass. Nun kann sie keiner mehr finden, die Tränen, die ich um dich weinte, aus Trauer, Unverstand. – Der Verlust deiner Liebe tut weh. – Sie ist unsichtbar, vergänglich, wie die Zeit und doch tut es weh, wenn sie fehlt. Es ist die Enttäuschung über den Verlust deiner Liebe und Wärme, deiner Zärtlichkeit und deines Lachens, das mich so schmerzt. Nicht wie ein Schnitt, nein, in meinem Herzen.
Es ist das Wissen, dass ich sie nicht zurückgewinne, dass ich sie durch mein inneres Sein nie zurückbekomme, nur weil du nicht alles weißt. – Du willst es wissen? Nein, das willst du nicht, denn dann reißt du eine Wunde auf, die mich schreien, kreischen, toben lässt.
- Was schaust du so? – Ich bin dein Kind, du solltest dich doch kennen; müsstest wissen, dass du nie über Gefühle sprichst.
Du, Wesen, Mensch, ja du, meine Liebe, ich vermisse dich! – Ich brauche dich! Ich liebe dich!
Mein Weg zum Schreiben
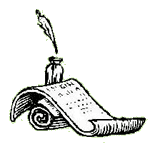
Die Sommerferien können einem schon ganz schön lang erscheinen, wenn alle Freunde im Urlaub sind und man selbst seit über drei Wochen zu Hause sitzt und nicht wirklich etwas mit sich anzufangen weiß.
– So ging es im Sommer 2004 auch mir. Es war einer dieser langweiligen Morgen, an dem ich sogar in der Tageszeitung blätterte, nur um mir die Zeit zu vertreiben.
Die normalen Seiten über Politik und Wirtschaft fand ich nicht wirklich interessant, aber ein kleiner Artikel weckte, als ich die Überschrift las, mein Interesse: „Literatur von und für Kinder“ – Was wohl hinter dieser Idee steckte.
Beim Lesen erfuhr ich, dass es um eine Internetseite ging, auf der Kinder und Jugendliche sich nach Herzenslust alles von der Seele schreiben könnten und am Ende stand auch die Adresse, unter der „Kalliope“ im Internet zu finden sei.
Da ich mich ohnehin immer noch langweilte, schaltete ich den Computer an und suchte nach der angegebenen Seite: http://www.kalliope-online.com und wurde auch fündig. „Besuchst du Kalliope zum ersten Mal? Dann herzlich willkommen!
Kalliope ist ein Internetportal für Kinder und Jugendliche, die gern Geschichten schreiben. Wenn du auch mitmachen möchtest, melde dich bitte rechts unten in der 'Registrierung' an.
Viele Informationen zu diesem Portal und was du hier alles machen kannst, gibt es links unter 'Informationen'.
Falls du Fragen oder Probleme hast, Wünsche oder Kritik loswerden möchtest, schick einfach eine Email.“
Die folgenden zwei Stunden verbrachte ich damit, Geschichten und Gedichte zu lesen, bis es mich selbst in den Fingern juckte und ich zu schreiben begann.
Es hat noch nicht mal einen Tag gebraucht, bis ich Ursula kennen lernte. Sie ist unser „Admin“ und hat oft alle Hände voll zu tun. Sie liest unsere Geschichten Korrektur (nur auf Rechtschreibung) und stellt sie dann ins Portal, damit alle anderen sie lesen können und ihre Meinung dazu in Form eines Kommentars schreiben können. –Je nach Thema entstehen so die tollsten Diskussionen.
Oft lesen Mitglieder nicht jeden Beitrag der anderen, sondern finden bald heraus, was sie interessiert oder welche Autoren ihnen am besten liegen. So ging es auch mir. Nach ungefähr einem Monat fühlte ich mich auf Kalliope richtig heimisch und genoss es, Texte einzusenden und fieberhaft auf den ersten Kommentar zu warten! Im Herbst 2004 gab es dann zum ersten Mal eine Herausforderung für uns. Ursula hatte einen Wettbewerb ausgeschrieben. Thema: „Weihnachten“.
Damals lief die Bewertung nicht durch eine Jury, sondern unsere Freunde ab. Alle Leute konnten eine Stimme abgeben und nicht nur Mitglieder, auch Freunde und Eltern. – Den Siegern winkte ein stattliches Preisgeld.
Im Sommer 2005 wurde dann der zweite (offiziell der erste) Wettbewerb veranstaltet, aus allen eingesendeten Geschichten und Gedichten wählte eine Jury die 50 gelungensten Werke aus und veröffentlichte sie in einem richtigen Buch unter dem Titel „Sommergeschichten“.
Der Erfolg war erstaunlich und das Buch ein echtes Schmuckstück!
Nun, ein halbes Jahr später durften wir erneut die Finger über die Tasten fliegen lassen. Das neue Thema: „Zu Besuch bei…“ sorgte anfangs für große Verwirrung, da niemand so recht wusste, wie er einen bereits Verstorbenen treffen sollte und in welcher Art und Weise das alles geschrieben werden sollte; Doch wir wären keine Kalliopeschreiber, wenn wir nicht auch dieses Problem in den Griff bekommen hätten.
Wenn es um die Wettbewerbe geht, steht jeder jedem mit Rat und Tat zur Seite und es gehen oftmals viele „private Nachrichten“ hin und her, bis sich jeder hinsetzt und lostippt.
Auch in diesem Wettbewerb kamen erstaunliche Werke hervor. Von „Kurt Cobain“ über „Orlando Bloom“ bis hin zu „US5“ war alles vertreten und man kann es manchmal gar nicht fassen, in welch erstklassigem Deutsch die Geschichten von so jungen Leuten geschrieben sind!
Da ist es auch nicht verwunderlich, dass es unserer Ursula nicht immer leicht fällt, die Siegerehrung reinzustellen und dass es hier und da auch schon einmal Krokodilstränen gab.
Alles in allem kann ich euch Kalliope nur weiter empfehlen! Nicht nur gegen langweilige Sommerferien, nein, auch zum Schmökern und selbst kreativ werden.
Unser Buch „Sommergeschichten“ ist übrigens auch im normalen Bücherhandel bestellbar. In nächster Zukunft wird auch „Zu Besuch bei…“ frisch aus dem Druck erscheinen!
Alles weitere zu „Kalliope“ und uns 693 Mitgliedern findet ihr im Internet unter http://www.kalliope-online.com.
Ich wünsche euch viel Spaß beim lesen und schreiben, die Anmeldung ist kostenlos und kinderleicht!
Ich und "Ottos Mops"
Aufgabe: Nachdem jeder Schüler das Gedicht "Ottos Mops" von Ernst Jandel erhalten hatte, sollte es auswendig gelernt werden.
Nach fünf Minuten wurde die Lernphase abgebrochen und jeder Schüler sollte einen inneren Monolog über die Zeit des Auswendiglernens schreiben.
Ich lese die Zeilen von Ernst Jandel, doch meine Gedanken eilen davon:
"Wie soll ich so was bitte auswendig lernen? 'ottos mops' wow- klasse- toller Geschmack.
'ottos mops trotzt' - der weiß schon, dass man Namen groß schreibt? - An dem Plakat fehlt ein Reißnagel.
- Oh Mann, dieses Gedicht ist echt zum Mäusemelken. "Schritt - Atemzug - Besenstrich", ich will in die Theaterprobe.
'ottos mops; ottos mops trotzt; otto: fort mops fort; ottos mops hopft fort; otto: soso'
Leute, ich habe keine Lust mehr- Ich muss auch noch meinen Text aus 'Momo` auswendig lernen - Schit- scheiß Bleistift!
`otto holt koks; otto holt obst; otto horcht; otto: mops mops; otto hofft` - Ja ja, ich hoffe auch- dass ich bald heim darf.
- Der Otto ist voll doof. - Wieso sind die alle so still?
`Ottos mops klopft; otto: komm mops komm; ottos mops kommt; ottos mops kotzt; otto: ogottogott'
- Otto ich geb dir recht- Der Tag ist echt gelaufen. Hehe, Herr Brünnle sieht das auch so - klasse Durchsage. - Muss weiter lernen;
'ottos mops
ottos mops trotzt
otto: fort mops fort
ottos mops mopst fort-' äh ne- so war des net.
Leute ich will heim-
Der Schnee ist fast weg- mal schauen, wann es wahr wird- Wenn ich den Jandel in die Finger bekomme *grrrr*
Also gut, noch mal:
'ottos mops
ottos mops trotzt
otto: fort mops fort
ottos mops hopft fort
otto: soso`
Jupy endlich- das war schon mal die erste Strophe.
Anna ist schon fertig - na gut, weiter:
otto holt koks
otto holt obst
otto horcht
otto: mops mops
otto hofft
Wow- ich bin stolz auf mich-
Der Jandel weiß schon, dass das Gedicht ein paar Kommas vertragen würde?
Ottos mops klopft
otto: komm mops komm
ottos mops kommt
ottos mops kotzt
otto: ogottogott
Ich mein zwar immer noch, dass der dem Otto net hilft, die Sauerei weg zu putzen, aber na gut!
Grinz - Frau Sandhaas ich kann's! =p"
Sehnsucht der Sterne
Jeden Tag und jedes Jahr steht er am selben Platz. Er ist noch jung, doch hat er schon so viel gesehen. Jeden Abend leuchtet er. Leise wird es auf der Welt und er steht noch immer dort oben. Eigentlich steht er ja nicht, sondern er zieht seine Bahnen … ruhig und friedlich. So schön ist es hier. Er liebt es die Planeten zu beobachten, vor allem einen. Die Bewohner nennen ihn „Erde“. Es ist ein schöner Planet, so blau und grün. Doch leider nicht mehr so friedlich wie vor einiger Zeit. Die Menschen schießen laute und Funken schlagende Waffen aufeinander.
Doch seit einigen Jahren, die für ihn selbst wie ein Wimpernschlag vergehen, interessiert er sich nur für ein Wesen. Es ist ein kleiner Mensch. Es ist ein Mädchen, mittlerweile zählt sie 14 Jahre und sie lebt direkt am Ozean. In einem kleinen Haus, zusammen mit ihrer Familie. Sie könnte eigentlich richtig glücklich sein. Aber das geht nicht. –Leider. Denn sie ist behindert. Lange wusste er nicht was das bedeutet, doch seit einem Jahr sitzt sie im Rollstuhl und kann nicht mehr gehen. Jeden Abend sitzt sie an ihrem Fenster und blickt hinauf zu den Sternen. Dann strengt er sich an und leuchtet. Leuchtet so stark er nur kann. Und das nur für sie.
Es ist dann als ob sie nur darauf warten würde. Denn ihr Blick, der sonst so tot und einsam wirkt. Ist dann fest, entschlossen und wunder schön.
Jeden Abend ist er für sie da. Seit einer Woche hat sie angefangen ihm von ihrem Leben zu erzählen. Nicht so wie die anderen Menschen sprechen, sondern in ihrer eigenen wundersamen Sprache. Die nur er verstehen kann. Und er liebt es.
Seit sie angefangen hat ihm zu erzählen merkt er erst wie lange die Zeit ist. Er kann es kaum erwarten bis ihr Vater sie wieder an ihr Fenster schiebt, ihr einen Gutenachtkuss gibt und das Fenster öffnet. So lange kann ein Tag sein. Selbst im Weltall.
Und das alles nur um einem kleinen Mädchen die Gelegenheit zu einem Lächeln zu schenken.
Ja, nur dafür lebt er. Der kleine Stern.